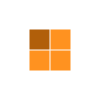Die Medizin befindet sich im Wandel: Neben hochspezialisierter Technik und molekularer Forschung wächst das Interesse an den Medical Humanities – einem interdisziplinären Feld, das Medizin mit Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Kunst verbindet.
Besonders spannend ist die Verbindung zur Epigenetik, die zeigt, wie Umwelt, Kultur und Lebensstil unsere Gene beeinflussen können. Die Medical Humanities helfen, epigenetische Forschung verständlich und menschlich zu machen – und zeigen, dass Gesundheit ein Zusammenspiel von Biologie, Kultur und Gesellschaft ist.
Die Verbindung von Medical Humanities und Epigenetik eröffnet eine neue Sichtweise auf Medizin: Sie macht deutlich, dass Gesundheit nicht nur im Körper, sondern auch in Geschichten, Kulturen und sozialen Strukturen entsteht. Deutschland, Österreich und die Schweiz sind dabei, diese Perspektive stärker in Forschung und Lehre zu verankern – ein Gewinn für die Medizin und die Menschheit insgesamt.
In Deutschland entstehen zunehmend Netzwerke wie das Greifswalder Zentrum für Medical Humanities, die Ärzt:innen und Geisteswissenschaftler:innen zusammenbringen. Hier wird diskutiert, wie epigenetische Erkenntnisse – etwa die Rolle von Stress, Ernährung oder sozialer Ungleichheit – durch Literatur, Kunst und Philosophie besser verstanden und vermittelt werden können.
Vorteil: Die Verbindung von Epigenetik und Medical Humanities hilft, die soziale Dimension von Gesundheit sichtbar zu machen und Patient:innen nicht nur biologisch, sondern auch kulturell und gesellschaftlich zu verstehen.
Die Universität Graz und Wien setzen mit ihren Programmen auf Themen wie Care-Kulturen, Altern und Krankheitsnarrative. Epigenetische Forschung zeigt, dass Pflegeumgebungen, psychische Belastungen und soziale Unterstützung direkte Spuren im Genom hinterlassen können.
Vorteil: Durch die Medical Humanities wird deutlich, dass Gesundheit nicht nur im Labor entsteht, sondern auch durch Sprache, Geschichten und soziale Praktiken geprägt wird.
In der Schweiz integrieren Universitäten wie Basel und Zürich die Medical Humanities in die medizinische Ausbildung. Epigenetik wird hier als Brücke verstanden lebende Biografien, deren Gene mit ihrer Umwelt in ständiger Wechselwirkung stehen. Sie macht sichtbar, wie Kultur, Umwelt und individuelle Erfahrungen biologische Prozesse beeinflussen.
Großer Vorteil für alle: Patient:innen werden nicht mehr nur als „medizinische Fälle“ betrachtet, sondern als Individuen.